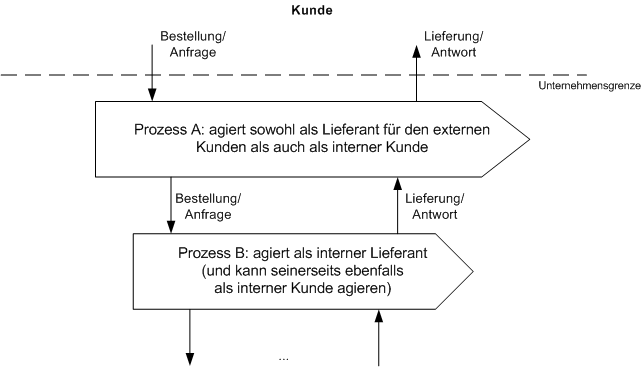Das Management eines prozessorientieren Unternehmens unterstützt aktiv das Prozessmanagement. Ohne Unterstützung durch das Management kann sich das Potential der Prozessorientierung nicht voll entfalten. Steht das Management nicht aktiv hinter dem Prozessgedanken und treibt es das prozessorientierte Denken nicht voran, ist das Risiko groß, dass das Prozessmanagement scheitert (Hinterhuber, 1995).
- Prozessorientierung sollte nicht als schnelle oder kurzfristige Lösung verstanden werden. Das Management eines Unternehmens sollte das Prozessmanagement nicht als einzelnes Projekt, sondern als langfristiges Commitment auffassen (Hammer, 2007).
- Im Idealfall hat das Unternehmen einen sogenannten Chief Process Officer (CPO) ernannt. Der CPO versteht das Konzept der Prozessorientierung in hohem Maße und ist für die unternehmensweite Weiterentwicklung des Prozessmanagements verantwortlich (Schmelzer und Sesselmann, 2006)
- Das Management des Unternehmens sollte aktiv im Prozessmanagement involviert sein (Hammer, 2007); z.B.
- Festlegung von Performance-Zielen für einzelne Geschäftsprozesse
- Entscheidung zwischen verschiedenen Design-Varianten eines Geschäftsprozesses
- etc.
Weitere Artikel zum Thema Management Commitment: